
02 Feb. Nora
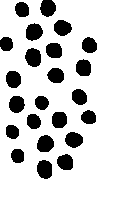
Wenn ich mir meinen Weg zur Hebamme vor Augen führe, wird mir bewusst, dass er von Anfang an von der außerklinischen Geburt begleitet war. Ähnlich einer alten Landstraße, die von mächtigen Bäumen gesäumt ist.
Meine erste Geburt erlebte ich mit 19 Jahren in einem Dorf in Mexiko, in dem ich mein freiwilliges soziales Jahr verbrachte.
Dieses Dorf liegt sehr abgelegen in den Bergen von Guerrero. Die Organisation Atzín, bei der ich damals arbeitete, hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, traditionelle Hebammen zu fördern und zu unterstützen.
So war es mir möglich, die Hebammen ein Stück weit bei ihrer Arbeit zu begleiten und bei einigen Hausgeburten anwesend zu sein.
Meine Erinnerungen an diese Geburten sind geprägt von einer sehr ruhigen, fast stillen Atmosphäre, der Dunkelheit, und der behaglichen Enge der Behausungen. Die Hebammen strahlten eine absolute Konzentration und gleichzeitig eine große Gelassenheit aus; wobei mir im Nachhinein klar ist, dass nicht alle Geburten komplikationslos waren. Bei einer Geburt zum Beispiel rutschte die Nabelschnur im Geburtskanal neben das kindliche Köpfchen, was in unseren Kreisen zurecht als ein seltener geburtshilflicher Notfall eingestuft wird. Da eine Verlegung in ein Krankenhaus, durch die Isolation des Dorfes, sehr viel Zeit beanspruchte, entschied sich die Hebamme die Geburt in dem Dorf fortzuführen. Sie hielt mit ihrer Hand die Nabelschnur zurück bis das Baby mehrere Stunden später gesund geboren wurde.
Die Sorge und der sicher enorme Kraftaufwand war der Hebamme, die die Gebärende weiterhin mit wenigen und ruhigen Worten durch die Geburt leitete, nicht anzumerken.
Man kann wohl sagen, dass mein erster Eindruck der Geburt und der Hebammentätigkeit etwas naiv und durchaus sehr positiv war. Für mich stand fest: Ich werde Hebamme!
Ein Jahr später begann ich mein Hebammenstudium in Christchurch, Neuseeland. Dorthin verschlug es mich durch meinen Mann, den ich einige Jahre zuvor bei einem Schüleraustausch kennenlernte.
Die außerklinische Geburt ist in Neuseeland, vor allem in den vielen ländlichen Gebieten, um einiges gewöhnlicher als in Deutschland. Hausgeburten und Geburten im Geburtshaus nahmen auch in der Ausbildung ganz selbstverständlich ihren Platz ein, ebenso wie Geburten in der Klinik.
Nun lernte ich also beide Seiten kennen, und war bei Klinikgeburten und auch bei Hausgeburten anwesend.
Keineswegs würde ich sagen, dass die Geburten in der Klinik in irgendeiner Weise abschreckend oder weniger bedeutungsvoll auf mich gewirkt hätten. Doch ähnlich wie in Mexiko, hat mich die Atmosphäre der Hausgeburten nachwirkend beeinflusst. Alles schien etwas ruhiger und auf eine angenehme Weise alltäglicher als in der Klinik.

Ich sehe es als großes Geschenk an, dass ich als werdende Hebamme gelernt habe, Vertrauen zu haben in die Kraft der Frau zu gebären und den natürlichen Geburtsablauf. Diese innere Sicherheit konnte ich mir bewahren, auch als sich nun meine Naivität in handfestes Wissen umwandelte.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass das Grundvertrauen in die normale Geburt jeder werdenden Hebamme bewusst vermittelt werden sollte. Deshalb sind Einsätze in der außerklinischen Hebammentätigkeit meiner Meinung nach sehr wichtig.
Nach drei Jahren endete meine Zeit als Studentin und das erste aufregende Berufsjahr begann. In Neuseeland haben alle frischen Hebammen im ersten Jahr eine Mentorin, da viele auf Grund der dortigen Strukturen, direkt in die Freiberuflichkeit starten. Meine Mentorin und Kollegin war eine sehr erfahrene Hebamme. Wir wohnten beide am Rande der Stadt und versorgten gemeinsam mit anderen Hebammen ein recht großes ländliches Gebiet. Viele Frauen waren Bäuerinnen und planten Geburten zu Hause oder im Geburtshaus. Zum einen, weil die Klinik ein Stück weit entfernt war und zum anderen, denke ich, weil Geburt durch ihre Arbeit ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens war.
Heute erinnere ich mich sehr wehmütig an diese Zeit zurück, trotz der rosaroten Brille. Ich genoss die langen Autofahrten auf dem Land, die aufregenden nächtlichen Anrufe, das Geburtshaus, welches mir so vertraut war, die Begleitung der Frauen und Familien und vor allem die Zusammenarbeit mit meiner lieben Kollegin.
In dieser Zeit wurde auch mein erstes Kind geboren. Für mich stand fest, dass ich Hausgeburten haben werde. Ich kann mich nicht erinnern diese Entscheidung irgendwann aktiv getroffen zu haben, es war für mich einfach der richtige Weg.
Meine erste Tochter ließ dann lange nach dem errechneten Termin auf sich warten und auch die Geburt war sehr langsam. Bis es dann einfach gar nicht weiter ging und ich einen Geburtsstillstand hatte. Gemeinsam mit meiner Hebamme entschieden wir in die Klinik zu verlegen. Ich bekam eine PDA und einen Wehentropf und durfte bald darauf endlich meine Tochter in den Armen halten.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich im Krankenhaus genau das bekommen habe, was ich gebraucht habe. Eine Hausgeburt zu planen heißt nicht „gegen“ Krankenhäuser zu sein, und als Hebamme im Geburtshaus zu arbeiten oder Hausgeburten zu begleiten heißt auch nicht, dass wir meinen jede Frau sollte eine außerklinische Geburt haben, oder dass Krankenhäuser in irgendeiner Weise „schlecht“ sind.
Im Gegenteil, ohne die Möglichkeit Frauen und Babys bei Bedarf in Kliniken verlegen zu können, könnten wir unsere Arbeit gar nicht ausüben und so haben wir eine große Wertschätzung und einen großen Respekt gegenüber den ärztlichen Kolleg*innen und den Hebammen in der Klinik.
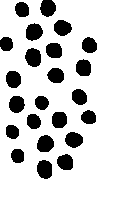
Aber nun zurück zu meinem Werdegang. Es folgte die erste Babyzeit meiner Tochter, in der ich weiter als Hebamme arbeitete und mein Mann mir das Baby zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Stillen brachte.
Ein etwas aufwendiges System, welches es mir allerdings ermöglichte, voll zu stillen und weiter als Hebamme zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln.
Zwei Jahre später wurde dann mein Sohn geboren. Dieses Mal zwar wieder langsam aber dennoch stetig, sodass ich ihn zu Hause zur Welt bringen konnte. Und wie herrlich es war, mich nach der Geburt in mein Bett zu legen, mit Mann, Tochter und frisch geborenem Baby.
Es folgte der Umzug nach Deutschland, um dieses Mal die erste Elternzeit ohne Arbeit genießen zu können. Da es in Neuseeland kein Elterngeld gibt, wollten wir uns das Jahr bei meinen Eltern in Hamburg „durchfuttern“. Aus diesem einen Jahr sind mittlerweile neun geworden und zu unseren zwei neuseeländischen Babys sind zwei deutsche dazugekommen.
Hier in Hamburg arbeitete ich in einer Klinik, was ich sehr gerne tat, da ich viele verschiedene Erfahrungen sammeln konnte und auch bei selteneren Verläufe routiniert arbeiten konnte.
Dennoch vermisste ich die außerklinische Hebammentätigkeit sehr, sodass ich voller Begeisterung beschloss, bei der Eröffnung des neuen Geburtshauses für Hamburg mitzuwirken. Ich kann es kaum erwarten, bis sich unsere Türen für die ersten Familien öffnen.
Die Hausgeburt meines letzten Kindes hat mir noch einmal verdeutlicht, was außerklinische Geburt für mich persönlich und beruflich bedeutet:
Im Vordergrund steht für mich weiterhin die Atmosphäre, der Geburt Raum und Zeit zu geben, die Vertrautheit und kontinuierliche Anwesenheit der Hebamme, das Einlassen auf die Frau als Individuum und die große Rolle die Partner*innen und Familien einnehmen können.
Unsere letzte Tochter wurde an einem Sonntagnachmittag geboren. Und es herrschte genau diese Mischung aus besonderer Atmosphäre und angenehmer Alltäglichkeit, an die ich mich aus meinen Schülerinnentagen erinnerte. Unsere Tochter wurde direkt und freudig von ihren drei Geschwistern begrüßt, die ihr ein spontanes Willkommensliedchen sangen. Die Geburt war ein absolutes Familienhighlight über das die Kinder auch jetzt noch oft sprechen.
Mein Wunsch ist es in unserem Geburtshaus Frauen und ihren Familien die Möglichkeit zu geben selbstbestimmt, in ruhiger Atmosphäre und vertrauensvoller und individualisierter Begleitung ihre Babys auf die Welt zu bringen.







